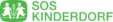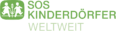Die wichtigsten Gütesiegel für Lebensmittel
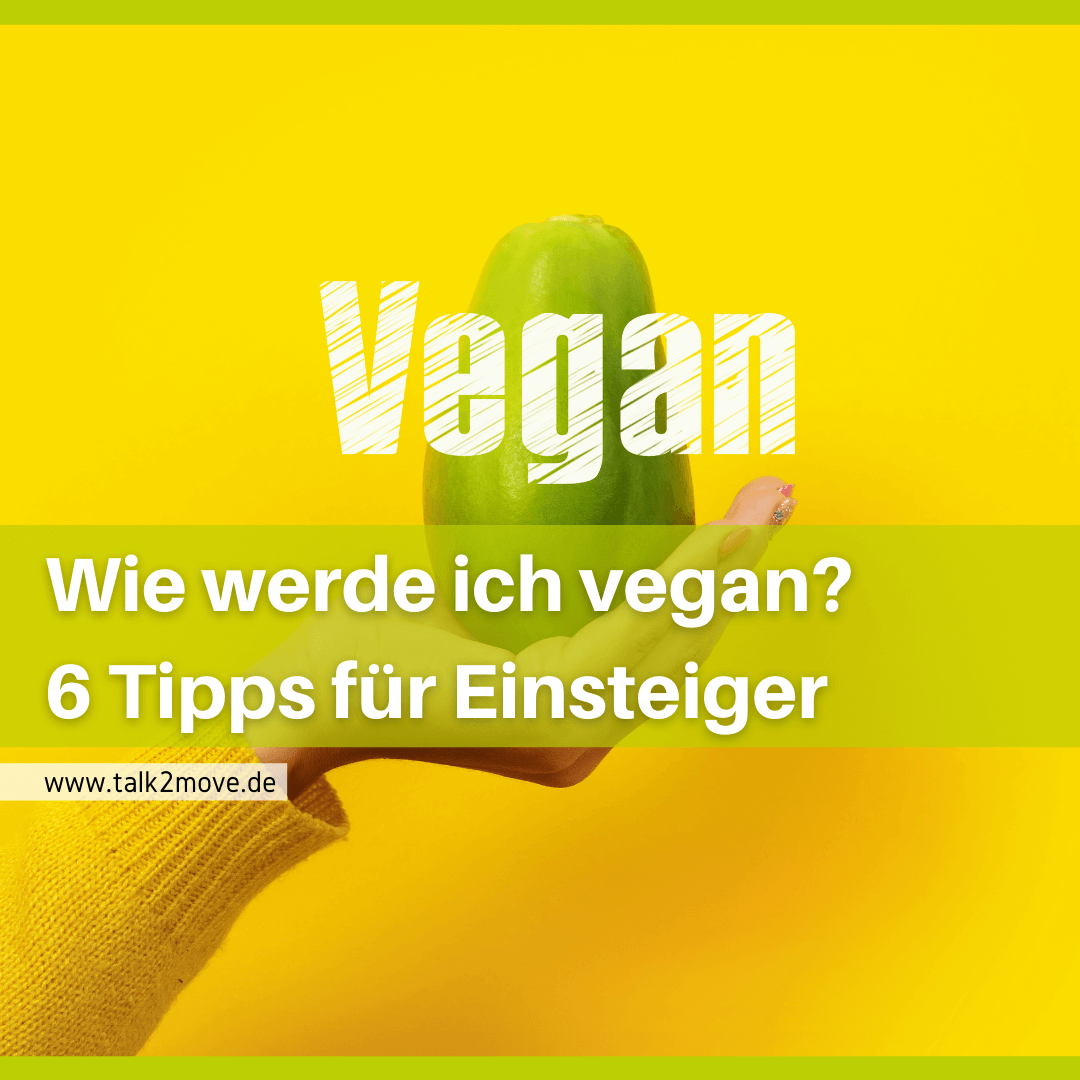
Wie werde ich vegan? 6 Tipps für Einsteiger*innen
16. November 2020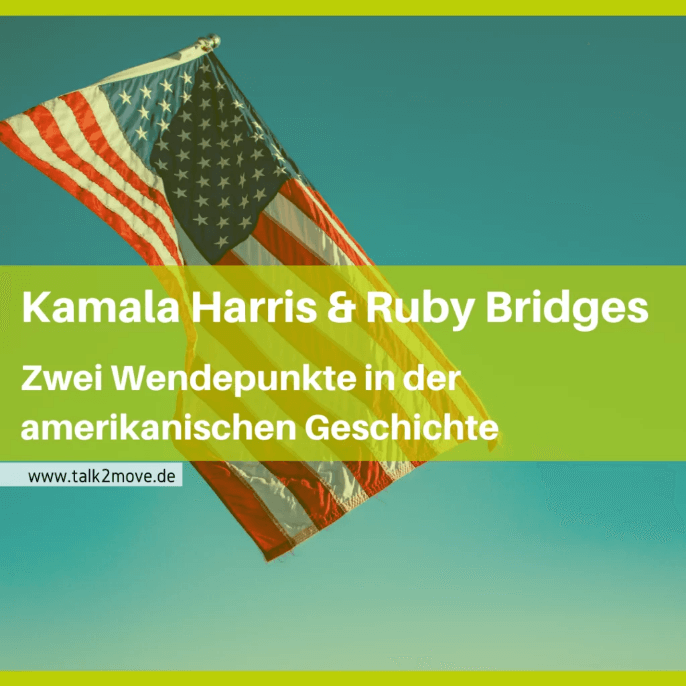
Kamala Harris & Ruby Bridges – Zwei Wendepunkte in der amerikanischen Geschichte
9. Dezember 2020Immer mehr Gütesiegel und Label sollen uns als Konsument*innen signalisieren, dass es qualitative Unterschiede zwischen den Produkten gibt und wir uns zwischen „besseren“ und „schlechteren“ Artikeln entscheiden können. Sie sollen die wahrgenommene Wertigkeit des Produktes erhöhen, Vertrauen schaffen und versprechen uns, dass wir fair und nachhaltig einkaufen.
Doch wer hätte es geahnt? Nicht jedes Siegel ist gut – zumal es mittlerweile so viele von ihnen gibt, dass man kaum noch einen Überblick über den Siegel-Dschungel hat. Allein In Deutschland gibt es über 1.000 Stück!
Auch auf Lebensmittel-Verpackungen tummeln sich eine Vielzahl an Siegeln, Herkunftszeichen und Symbolen. Welche Voraussetzungen für die Vergabe solcher Label und Prüfzeichen erfüllt sein müssen, ist sehr unterschiedlich und auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Teilweise gehen die Kriterien auch nicht über die gesetzlich vorgeschriebenen Regeln hinaus. Sie rufen aber Qualitätserwartungen hervor und werden daher gerne zu Werbezwecken eingesetzt.
Vertrauenswürdige Siegel ermöglichen es uns wiederum, uns bewusst für eine bestimmte Art der Lebensmittelerzeugung, z.B. für Bio-Produkte, zu entscheiden. Die wichtigsten nachhaltigen Siegel, die du unbedingt kennen solltest, haben wir nach Kategorien geordnet und erklären, was sie bedeuten.

Bio ist nicht gleich Bio
Lebensmittel aus biologischem Anbau liegen voll im Trend. Sie weisen wesentlich weniger Pestizidrückstände auf als konventionelle Lebensmittel. Der ökologische Landbau fördert im Gegensatz zu den Monokulturen der intensiven Landwirtschaft die biologische Vielfalt, naturnahe Grünlandflächen und die Fruchtbarkeit der Böden. Diese Anbauweise strebt eine Kreislaufwirtschaft mit möglichst geschlossenen Nährstoffzyklen sowie eine artgerechte Tierhaltung an.1
Wo Bio drauf steht, ist zum Glück auch Bio drin, denn die Begriffe biologisch und ökologisch sind durch eine Verordnung der EU gesetzlich geschützt. Diese schreibt Mindestkriterien für den ökologischen Landbau vor. Doch Bio ist nicht gleich Bio. Welche Biosiegel es gibt und was sie bedeuten, erklären wir im Folgenden.
EU-Bio-Siegel
Das EU-Bio-Siegel ist eines der am meisten verbreiteten Labels für Lebensmittel. Es wurde am 1. Juli 2010 EU-weit verbindlich eingeführt und kennzeichnet Produkte, die aus ökologischer Landwirtschaft stammen und deren Erzeuger oder Verarbeiter die Kriterien für ökologischen Landbau einhalten, so wie sie das EU-Recht definiert. Wer also innerhalb der EU seine Produkte „Bio“ oder „öko“ nennen möchte, der braucht verpflichtend dieses Siegel. Freiwillig können auf den Produkten auch weitere Bio-Logos abgedruckt werden.2
Die wichtigsten Kriterien im Überblick
- Alle verpackten Bio-Produkte müssen das EU-Bio-Label tragen
- Nur ein Lebensmittel, das den Kriterien zu mindestens 95 Prozent entspricht, darf „Bio“ oder „öko“ genannt werden.
- Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutz- und Düngemittel
- höchstzulässige Anzahl von Tieren pro Hektar
- artgerechte Haltungsformen
- biologische Futtermittel sowie Verbot von präventiver Antibiotika-Gabe
- Verbot von Gentechnik
- Verarbeitung: nur 53 Zusatzstoffe zugelassen (konventionelle Produkte in der EU: 316)
- Seit 2010 gibt es auch EU-Standards für gezüchteten Bio-Fisch aus Aquakulturen mit Kriterien zu tiergemäßen Haltungssystemen, maximalen haltungsdichten und nachhaltigen Futtermitteln.2

Deutsches Bio-Siegel
In Deutschland findet man gelegentlich noch das deutsche Bio-Siegel mit sechs Ecken, welches Produkte kennzeichnet, die der EG-Öko-Verordnung genügen. Es wurde 2010 vom EU-Bio-Siegel abgelöst. Jedoch verwenden viele Hersteller das deutsche Bio-Zeichen parallel weiter, einfach des hohen Bekanntheitsgrads wegen. Oft versehen sie ihre Produkte auch mit beiden Siegeln.2
Bioeigenmarken
Viele Supermarktketten und Discounter haben auch eigene Bio-Zeichen, wie z.B. die Marken REWE Bio, real Bio, GUTBIO (Aldi Nord) oder Lidl Bio. Auch hier gilt: Alle Produkte müssen die EU-Mindeststandards für Bio-Lebensmittel erfüllen und mit dem EU-Bio-Siegel gekennzeichnet sein. Du kannst dich also auch bei Aldi, Lidl & Co. auf alle gängigen Bio-Siegel verlassen, denn der Begriff ist für Lebensmittel gesetzlich geschützt und die Erzeuger-Betriebe werden regelmäßig kontrolliert.3
Bio-Zeichen der Anbauverbände
Wer Lebensmittel mit dem grünen EU-Bio-Siegel kauft, ist zwar bereits auf dem richtigen Weg – doch es geht noch besser: Denn die europäische Bio-Zertifizierung definiert nur Mindeststandards für die ökologische Landwirtschaft und Tierhaltung. Besser ist es demnach Produkte mit den Siegeln der Bio-Anbauverbände zu kaufen, denn diese legen für ihre Zertifizierung deutlich strengere Kriterien an als die EU-Richtlinie, gerade was die Tierhaltung angeht. Die EU-Richtlinien lassen beispielsweise in der Tierhaltung deutlich höhere Besatzdichten zu, erlauben es, bei Bedarf konventionelles Futter und konventionellen Dünger zu verwenden und genehmigen in der Verarbeitung deutlich mehr Zusatzstoffe (EU-Bio: 53, Bioland & Naturland: 22, Demeter: 21).3
Zu den Bio-Anbauverbänden in Deutschland gehören Bioland, Naturland, Demeter, Biokreis, Biopark, Gäa, Verbund Ökohöfe und Ecoland. Extra für Wein gibt es noch den Verband Ecovin.
Die höheren Ansprüche der einzelnen Anbauverbände machen die Erzeugung von Bio-Lebensmitteln aufwändiger und teurer als nur EU-Bio. Um den Kunden die anspruchsvollere Bio-Qualität aufzuzeigen, sind die Produkte zusätzlich zum obligatorischen EU-Bio-Siegel mit den eigenen Logos der Anbauverbände gekennzeichnet. Die drei größten Verbände stellen wir im Folgenden vor:

Bioland
Bioland ist der größte ökologische Anbauverband in Deutschland – mit über 7.700 Erzeuger-Betrieben (Landwirte, Gärtner, Imker und Winzer) und über 1.100 Partnern aus Herstellung und Handel (z.B. Bäckereien, Molkereien, Metzgereien und Gastronomie). Das wichtigste Ziel von Bioland ist es, „den organisch-biologischen Landbau umzusetzen, zu fördern und zu verbreiten“. Dazu hat Bioland sieben Prinzipien4 entwickelt:
- Im Kreislauf wirtschaften
- Bodenfruchtbarkeit fördern
- Tiere artgerecht halten
- Wertvolle Lebensmittel erzeugen
- Biologische Vielfalt fördern
- Natürliche Lebensgrundlagen bewahren
- Menschen eine lebenswerte Zukunft sichern
Die wichtigsten Kriterien im Überblick
Mitglieder des Verbandes müssen zu 100 Prozent ökologisch produzieren, ohne Kunstdünger und Pestizide. Außerdem ist Biosaatgut vorgeschrieben sowie eine Behandlung erkrankter Tiere mit Naturheilverfahren.5 Die Wirtschaftsweise der Bioland-Betriebe basiert auf einer Kreislaufwirtschaft, bei der Tierdung aus eigener Tierhaltung dem Boden wieder Nährstoffe zuführen soll. Zudem legt Bioland viel Wert auf Regionalität: Nur Erzeugerbetriebe in Deutschland und Südtirol werden mit dem Siegel ausgezeichnet.6
Die ökologischen Standards des Labels gehen über die gesetzlich vorgeschriebenen Kriterien für das EU-Bio-Siegel hinaus:
- Gesamtbetriebsumstellung auf Bio vorgeschrieben
- Beschränkung der Düngemenge
- Weniger Geflügel und Schweine pro Hektar Fläche
- Weidegang für Rinder
- ständiger Auslauf für Legehennen
- Tiertransporte maximal vier Stunden und 200 Kilometer
- 100 % Biofutter, mindestens 50 % des Futters vom eigenen Betrieb oder regionaler Kooperation
- Verarbeitung: nur 22 Zusatzstoffe zugelassen (EU-Bio: 53)

Demeter
Der Demeter e.V. ist der älteste Bio-Anbauverband in Deutschland. Schon seit 1924 bewirtschaften Demeter-Landwirte ihre Felder biodynamisch. Aufgrund der lebendigen Kreislaufwirtschaft gilt die Demeter-Landwirtschaft als nachhaltigste Form der Landbewirtschaftung. Die Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise geht auf Impulse Rudolf Steiners zurück, der Anfang des 20. Jahrhunderts auch Waldorfpädagogik und anthroposophische Heilweise initiierte.7
In Deutschland wirtschaften 1.700 Landwirt*innen mit rund 93.000 Hektar Fläche biologisch-dynamisch. Zum Verband gehören zudem etwa 320 Demeter-Hersteller und knapp 100 Hofverarbeiter sowie 140 Vertragspartner aus dem Naturkost- und Reformwaren-Großhandel. 7
Die wichtigsten Kriterien im Überblick
Hinter der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise steht der Gedanke, dass jeder Hof zu einem Organismus ausgestaltet sein soll, der aus sich selbst heraus lebensfähig ist. Demeter-Bauern sind laut Richtlinien verpflichtet, bestimmte Präparate aus Heilkräutern, Mineralien und Kuhdung regelmäßig zu verwenden.
Die ökologischen Standards des Labels gehen über die gesetzlich vorgeschriebenen Kriterien für das EU-Bio-Siegel hinaus8:
- Gesamtbetriebsumstellung auf Demeter vorgeschrieben
- Strikte Vorgaben zu Pflanzenschutzmittel
- Beschränkung der Düngemenge
- Verarbeitung: nur 21 Zusatzstoffe zugelassen (EU-Bio: 53)
- Die Tierhaltung ist auf Demeter-Bauernhöfen obligatorisch, um hochwertigen Kompost für den Ackerbau zu erzeugen. Hier gilt:
- Weniger Geflügel und Schweine pro Hektar Fläche
- Auslauf für Rinder, Weidegang so viel wie möglich
- Enthornung von Rindern verboten, Haltung enthornter oder genetisch hornloser Rinder (mit wenigen Ausnahmen) verboten
- Auslauf für Legehennen
- 100 % Biofutter, mindestens 50 % des Futters vom eigenen Betrieb oder regionaler Kooperation

Naturland
Naturland zählt neben Bioland und Demeter zu den drei größten ökologischen Anbauverbänden, die strengere Richtlinien als die EU haben und mit hohen Standards an der Spitze der Bio-Labels stehen. Das Naturland-Label wurde 1982 von Wissenschaftlern, Landwirten und Verbrauchern mit dem Ziel gegründet, den ökologischen Landbau weltweit zu fördern. Inzwischen ist Naturland einer der größten Öko-Verbände weltweit:
Mit 70.000 Bäuerinnen und Bauern, Imkern und Fischwirten in 60 Ländern der Erde stehen wir dafür, dass ein ökologisches, soziales und faires Wirtschaften weltweit im Miteinander ein Erfolgsprojekt ist. Allein in Deutschland gehören 4.000 Erzeuger unserer Gemeinschaft an. Naturland steht wie kein anderer Öko-Verband für den harmonischen Zweiklang von Regionalität und Internationalität in einer globalisierten Welt.9
Die wichtigsten Kriterien im Überblick
Das Label setzt bei Anbau und Verarbeitung von Nahrungsmitteln auf hohe ökologische Standards und berücksichtigt soziale Aspekte, wie den Ausschluss von Kinderarbeit oder die Wahrung der Menschenrechte.
Naturland geht mit seinen strengen Kriterien über die Mindeststandards des EU-Bio-Siegels hinaus, beispielsweise hiermit 10:
- Gesamtbetriebsumstellung auf Bio vorgeschrieben
- Beschränkung der Düngemenge
- Weniger Geflügel und Schweine pro Hektar Fläche
- Weidegang für Milchvieh
- ständiger Auslauf für Legehennen
- Tiertransporte maximal acht Stunden
- Mindestens 50 Prozent des Futters vom eigenen Betrieb
- Verarbeitung: nur 22 Zusatzstoffe zugelassen (EU-Bio: 53)

Seit 2010 können sich Naturland Erzeuger und Verarbeiter aus einer Hand Öko und fair zertifizieren lassen. Für die Zertifizierung Naturland Fair müssen sieben zusätzliche soziale Hauptanforderungen erfüllt werden 11:
- Sozialrichtlinien
- Verlässliche Handelsbeziehungen
- Faire Erzeugerpreise
- Regionaler Rohstoffbezug
- Gemeinschaftliche Qualitätssicherung
- Gesellschaftliches Engagement
- Unternehmensstrategie und Transparenz
Siegel für Fair-Trade-Produkte

GEPA fair+ (Vorreiter des fairen Handels)
1975 wurde die „Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten Welt mbH“ gegründet. Heute nennt sich das Unternehmen „GEPA – The Fair Trade Company“ und ist eines der größten europäischen Fair-Handelsunternehmens, das seit über 40 Jahren Produkte und Rohstoffe von auf dem Weltmarkt benachteiligten Produzenten vor allem der südlichen Länder zu fairen Bedingungen importiert und in Deutschland vermarktet. Die Gewinne werden wieder im Fairen Handel angelegt, so dass zum Beispiel Handelspartner bei der Umstellung auf ökologischen Anbau und mit Vorfinanzierungen unterstützt werden können.12
Die drei Kernziele der GEPA im Überblick
- Produzent*innen im Süden nachhaltig unterstützen
- Konsument*innen aufklären
- zur Veränderung ungerechter Welthandelsstrukturen beitragen13
Das GEPA Fair+ Zeichen kennzeichnet Produkte aus fairem Handel und ist auf vielen Lebensmitteln wie z.B. Kaffee oder Schokolade zu sehen. Fair bedeutet zwar nicht automatisch Bio, aber 78 Prozent der Produkte tragen das EU-Bio-Siegel (Stand 2/2018) und sind teils auch Naturland-zertifiziert. Ein strategisches Ziel des Unternehmens ist, dass fair und Bio zusammen gehören. Der Bio-Landbau wird daher aktiv unterstützt. 12
Die GEPA ist …
- als Organisation 100 Prozent fair
- geprüft nach dem Garantiesystem der WFTO – als eines von wenigen Unternehmen in Deutschland
- glaubwürdig und transparent
- getragen von der Fair Handelsbewegung, mit u. a. 800 Weltläden und über hunderttausend Engagierten
- international im Fairen Handel vernetzt13
Fairtrade
Beim Fairtrade-Siegel handelt es sich um ein Sozialsiegel. Kleinbauern und Kleinbäuerinnen erhalten hier einen garantiert kostendeckenden Preis für ihre Waren, auch wenn die Weltmarktpreise schwanken. Der faire Handel strebt langfristige Handelsbeziehungen zwischen allen Handelspartner*innen an. Eine zusätzliche Fairtrade-Prämie wird in gemeinschaftliche Projekte gesteckt.
Darüber hinaus sind bestimmte Pestizide verboten und ökologische Bewirtschaftung wird belohnt. Dennoch ist das Fairtrade-Siegel nicht vergleichbar mit Öko-Standards wie dem EU-Bio-Siegel. Viele Fairtrade-Produkte tragen zwar ein Bio-Siegel, aber nicht alle: Etwa 70 Prozent der Produkte mit Fairtrade-Siegel sind gleichzeitig auch Bio. Außerdem müssen sich alle Produkte vollständig zurückverfolgen lassen und Rohstoffe getrennt von nicht zertifizierten Rohstoffen gelagert und verarbeitet werden.14
Die wichtigsten Kriterien im Überblick
Die Kriterien erstrecken sich auf soziale, ökologische und ökonomische Aspekte entlang der Lieferkette 14:
Soziale Kriterien:
- Fairtrade achtet auf die Organisation in demokratischen Gemeinschaften (bei Kooperativen) und die Förderung gewerkschaftlicher Organisation (auf Plantagen).
- Zwangs- und Kinderarbeit sowie Diskriminierung sind verboten.
- Verboten sind auch Tests, die Diskriminierung hervorrufen könnten (z.B. HIV-Tests, Schwangerschaftstests).
- Produzent*innen sollen ihre Angestellten über Arbeitsrechte unterrichten und Arbeitsverträge aushandeln.
- Angestellte haben Zugang zu Trinkwasser und medizinsicher Versorgung.
Ökologische Kriterien:
- Fairtrade fordert einen umweltschonenderen Anbau, den Schutz der Biodiversität sowie eine nachhaltige Energie- und Wassernutzung und Müllvermeidung.
- Gefährliche Pestizide (gemäß einer eigenen „Rote Liste“) sowie gentechnisch verändertes Saatgut sind verboten.
- Der Einsatz von bestimmten Herbiziden ist unter Auflagen erlaubt und muss auf ein Minimum beschränkt sein.
- Waldrodung für neue Ackerflächen ist nicht erlaubt.
- Produzent*innen müssen sich und ihrer Angestellten für Bodenerosion sensibilisieren und Präventionsmaßnahmen ergreifen.
- Farmer*innen müssen nachhaltige Maßnahmen für die veränderte Landwirtschaft aufgrund des Klimawandels entwickeln.
Ökonomische Kriterien:
- Fairtrade bezahlt Mindestpreise und schüttet Fairtrade-Prämien aus.
- Die Händler*innen verpflichten sich zu transparenten und langfristigen Handelsbeziehungen.
- Projekte können vorfinanziert werden, um Farmen zu unterstützen.

Rapunzel Hand in Hand
Die Rapunzel Naturkost GmbH ist einer der führenden Bio-Hersteller in Europa. Seit 1974 verarbeitet und handelt Rapunzel mit biologisch produzierten Rohstoffen, seit 1988 auch mit biologischen Rohstoffen aus aller Welt. Die Grundüberzeugung ist, dass ökologische Nachhaltigkeit immer auch ökonomische und soziale Nachhaltigkeit braucht. Das Hand-in-Hand-Programm verknüpft daher den Gedanken des fairen Handels mit dem des ökologischen Landbaus. Heute tragen über 150 Produkte das Hand-in-Hand-Siegel.15
Die wichtigsten Kriterien im Überblick
Die sozialen und ökologischen Kriterien, die über die gesetzliche Vorgabe hinausreichen und sowohl Produktionsbedingungen als auch Produktqualität berücksichtigen, sind Grundlage für das Hand in Hand-Siegel16:
Soziale Kriterien:
- Die Zahlung eines existenzsichernden Lohns ist verpflichtend, und für die Umsetzung dieses Kriteriums sind ausreichende Instrumente vorhanden. Um die Lohnzahlungen beurteilen zu können, werden in den Audits auch die Arbeitszeiten und die Stücklöhne geprüft.
- Unabhängige Beschwerdemechanismen existieren und die Meldungen fließen in den Audit-Prozesses (Überprüfungsprozess) ein.
- Es gibt Schulungen zu Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie zu Arbeitsrechten.
Ökologische Kriterien:
- Der Einsatz gefährlicher Chemikalien ist untersagt.
- Der Einsatz von GVO (gentechnisch veränderten Organismen) ist in der gesamten Lieferkette untersagt (einschließlich als Futtermittel in tierischen Produkten).
- Das Zertifizierungssystem verlangt die Durchführung einer regelmäßigen UVP (Umweltverträglichkeitsprüfung).
- Es gilt ein Verbot von Brandrodung, sowie der Rodung von Primärwald, nicht jedoch ein ausdrückliches Verbot der Regenwaldzerstörung.

Das Netz der weltweiten Rapunzel HAND IN HAND-Partner (https://www.rapunzel.de/hand-in-hand.html)

Rainforest Alliance
Rainforest Alliance wird oft als Alternative zu den bereits vorgestellten Fairtrade-Siegeln genannt, ist aber eigentlich kein Fairtrade-, sondern vielmehr ein Nachhaltigkeitssiegel. Zwar fordert es soziale und ökologische Standards ein, ist aber weder ein Siegel für fairen Handel noch für ökologischen Anbau. Daher reichen die Kriterien der Rainforest Alliance nicht an die des Fairtrade- oder EU-Bio-Siegels heran.
Allerdings hat die Organisation im Sommer 2020 neue Kriterien veröffentlicht und damit ihre Anforderungen für eine nachhaltige Landwirtschaft deutlich verschärft. Die neuen Kriterien fordern zum Beispiel, dass Farmen die Biodiversität schützen müssen, klimabewusste Landwirtschaft betreiben sollen und keinen natürlichen Wald für neue Plantagen abholzen dürfen. Das Label UTZ Certified gehört zur Rainforest Alliance. Etwa ein Viertel der weltweiten Kakao- und Kaffee-Produktion ist inzwischen von ihr zertifiziert.17

Die wichtigsten Kriterien im Überblick
Charakteristisch für das Siegel ist, dass es nicht nur Verbote formuliert, sondern dass Farmen und Unternehmen selbst Risikoanalysen in allen Bereichen durchführen müssen. Dadurch sollen sie selbst Missstände erkennen, noch bevor sie auftreten und dann auch verhindern können. Folgende Kriterien sind verbindlich17:
- Mindestens 90 Prozent eines Rohstoffs muss von Rainforest-Alliance-zertifizierten Farmen stammen (Beispiel: Kaffeebohnen).
- Enthält ein Produkt mehrere Zutaten, müssen mindestens 30 Prozent von Rainforest-Alliance-zertifizierten Farmen stammen.
- Der zertifizierte Rohstoff muss sich vollständig zurückverfolgen lassen und muss von nicht-zertifizierten Rohstoffen getrennt gelagert werden.
- Mengenausgleich ist erlaubt
Soziale Kriterien:
- Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit, Diskriminierung und Gewalt am Arbeitsplatz gemäß ILO (International Labor Organisation)
- Gewerkschaften, Betriebsräte und eine Beschwerdestelle müssen erlaubt sein.
- Förderung junger Arbeiter*innen
- Nachhaltigkeitszuschlag für Farmen, der ab Juli 2022 beispielsweise mindestens 70 US-Dollar pro Tonne Kakao betragen muss
- Angemessene Bezahlung (mindestens Mindestlohn oder Tariflohn)
- Zugang zu Trinkwasser und medizinischer Versorgung für Mitarbeiter*innen
Ökologische Kriterien:
- Diversifikation und Mischkultur mit unterschiedlicher Wurzeltiefe, um die Bodenqualität zu erhalten
- Verbot von gentechnisch veränderten Pflanzen
- Regelmäßige Bodenbegutachtung und Bodenentwicklungsplänen
- Dünger muss so verwendet werden, dass der Umwelteinfluss so gering wie möglich ist.
- Biologische Methoden zur Schädlingsbekämpfung müssen bevorzugt angewandt werden. Erst wenn diese erfolglos bleiben, dürfen synthetische Pestizide eingesetzt werden.
- Bestimmte Chemikalien sind verboten, zum Beispiel Borsäure und Fipronil.
- Natürlicher Wald und naturbelassene Ökosysteme dürfen nicht in landwirtschaftliche Fläche umgewandelt werden.
Siegel für vegetarische und vegane Produkte
EcoVeg
Vegane Produkte zu erkennen, ist nicht immer leicht. Denn in vielen Lebensmitteln gibt es versteckte tierische Inhaltsstoffe. Wer auch noch Wert auf Bio-Qualität legt, sucht oft vergebens. Das EcoVeg-Siegel vereint beide Kriterien und zertifiziert ausschließlich vegane Lebensmittel in Bio-Qualität. Als Grundlage dienen die europäische Öko-Verordnung und eigene Definitionen, was überhaupt „vegan“ ist. Denn der Begriff ist in keinem Gesetz definiert.24
Der gemeinnützige Verein VegOrganic e.V. ist 2014 von verschiedenen Bio-Experten und Branchenvertretern gegründet worden. Sie engagieren sich privat in dem Verein und setzen sich für eine transparente und unabhängige Kontrolle veganer Bio-Lebensmittel ein. Diese komme bei anderen Siegeln zu kurz, weshalb der Verein mit EcoVeg ein eigenes Label gegründet hat.18
Die wichtigsten Kriterien im Überblick
- Pflanzlich: Es dürfen nur pflanzliche Lebensmittel in einem Produkt verwendet werden. Dies gilt auch für zusammengesetzte Lebensmittel.
- Ohne Tiere: Zutaten und technischen Hilfsstoffe dürfen nicht aus / durch tierische Organismen gewonnen sein.
- Trennung: Sollte ein Unternehmen auch Lebensmittel mit tierischen Inhaltsstoffen herstellen, müssen die Chargen zeitlich und/oder räumlich getrennt hergestellt werden.
- Lagerung: Unternehmen müssen die Rohstoffe für vegane Lebensmittel räumlich getrennt von tierischen Produkten lagern. Auch die Endprodukte müssen räumlich getrennt von nicht-veganen Lebensmitteln gelagert werden.
- Bio: Das EcoVeg-Siegel darf nur in Verbindung mit einem gültigen EU-Bio-Label verwendet werden.18
Hier findest du das Siegel
In konventionellen Supermärkten ist das Siegel derzeit noch selten anzutreffen, in Bio-Supermärkten dagegen häufiger: Zertifiziert sind vor allem die Eigenmarken von Bio Company und Dennree. Darüber hinaus sind viele Markenprodukte von Taifun Tofu, Purvegan, Wheaty, Viana, Soyatoo, Kato und der Sunflower Family mit dem EcoVeg-Siegel zertifiziert. Dass die Verfügbarkeit nicht so hoch wie bei anderen Vegan- oder Bio-Siegeln ist, liegt daran, dass die Kombination aus vegan und Bio nicht so häufig vorkommt und wenn, dann vor allem in Bio-Supermärkten zu finden ist.18

V-Label: das Europäische Siegel für vegetarische und vegane Produkte
Damit Veganer*innen und Vegetarier*innen besser erkennen können, welche Lebensmittel sich für ihre Ernährungsweise eignen, hat die Europäische Vegetarier-Union (EVU) im Jahr 1996 das V-Label ins Leben gerufen. Mit dem V-Label kann man tierfreie Produkte schnell erfassen, ohne lange die Zutatenliste zu studieren.
Aber Achtung! Die ausgezeichneten vegetarischen oder veganen Produkte sind nicht automatisch gesünder oder immer mit Tierschutz verbunden. Denn die Auszeichnung der vegetarischen Produkte sagt nichts über die Herkunft der darin verwendeten Zutaten lebender Tiere wie zum Beispiel Milch aus. Selbst wenn ein Produkt als vegetarisch gekennzeichnet ist, kann es trotzdem Milch aus Massentierhaltung enthalten.19
Das V-Label wird in zwei Kategorien (vegetarisch und vegan) vergeben. Beide Kategorien haben gemeinsam, dass gekennzeichnete Produkte keine Zutaten bzw. Substanzen von getöteten Tieren enthalten dürfen. Damit ein Produkt das Label tragen kann, muss es außerdem tierversuchsfrei sein. Das bedeutet, dass das Unternehmen für den Artikel selbst und seine Inhaltsstoffe keine Versuche an Tieren in Auftrag geben darf. Das wird jährlich geprüft.
Die wichtigsten Kriterien im Überblick
Keine der folgenden Zutaten dürfen enthalten sein:
- Schlachtprodukte (z.B. Fleisch, Geflügel, Fisch, Meeresfrüchte)
- Zutaten, die aus Fleisch oder Knochen hergestellt werden (in Suppen, Soßen oder Zubereitungen)
- Aromen tierischer Herkunft
- Eier von Hühnern aus Käfighaltung
- andere Eier (außer Geflügeleier) wie zum Beispiel Kaviar
- GVO (gentechnisch veränderte Organismen)
- Tierische Fette (Ausnahme: Butterfett), Bratfette oder Margarine, die Fischöl oder ähnliche Produkte enthalten, z. B. in Kuchen, Aufläufen, Pasta
- Farbstoffe aus tierischen Bestandteilen
- Zucker, der mit Tierkohle gebleicht wurde
- Klärung mit Gelatine, Fischblasen
- Gelée Royale (spezielles Bienenprodukt)19
Produkte in der Kategorie vegan müssen außerdem frei sein von:
- Milchprodukten
- Geflügeleiern
- Honig
- Tierischem Wachs
- Anderen Produkten aus tierischen Erzeugnissen (z.B. Farbstoffe, Trägerstoffe, Klärstoffe)19
Was das V-Label nicht abdeckt:
- Bei unbeabsichtigten, technisch unvermeidbaren Einträgen von Erzeugnissen, die den Kriterien des Labels nicht entsprechen, wird es trotzdem vergeben. Das bedeutet, dass durch zufällige Verunreinigungen trotzdem unerwünschte Allergene enthalten sein können.
- Das V-Label bewertet Zutaten ab der Ernte. Das heißt, es ist nicht verboten, sie mit tierischen Stoffen zu düngen.
- Auch die Verpackung kann theoretisch tierische Inhaltsstoffe enthalten.19

Die Veganblume der Vegan Society
Auch die Veganblume hilft im Dschungel der Produkte den Durchblick für vegane Artikel zu behalten. 1944 wurde die Vegan Society vom Engländer Donald Watson gegründet, auf den auch die Wortschöpfung „vegan“ zurückgeht. Seit 1990 zeichnet die Veganblume Lebensmittel, Kosmetik und andere Artikel aus, um Veganer*innen die Produktauswahl zu erleichtern. Im deutschsprachigen Raum ist die Vegane Gesellschaft Österreich der zuständige Ansprechpartner.20
Die wichtigsten Kriterien im Überblick
- Bei der Herstellung und/oder Entwicklung des Produktes dürfen keine tierischen Produkte, keine tierischen Nebenprodukte oder aus Tieren gewonnene Rohstoffe verwendet werden oder verwendet worden sein. Als ‚Tiere‘ versteht die Vegan Society alle Wirbeltiere und mehrzellige wirbellose Tiere.
- Herstellende Unternehmen dürfen weder selbst Tierversuche durchführen noch Dritte damit beauftragen.
- Wenn eine Firma sowohl vegane als auch konventionelle Produkte herstellt, müssen alle Maschinen gründlich gereinigt werden, bevor sie wieder mit veganen Stoffen in Berührung kommen.
- Sollte ein Produkt gentechnisch veränderte Organismen (GVOs) enthalten, muss dies auf der Verpackung gekennzeichnet werden.
- Die Herstellung oder Entwicklung von GVOs durch Tiergene oder durch von Tieren gewonnene Substanzen ist untersagt.20
Vorsicht ist geboten!
Die vegane Ernährung wird häufig mit Gesundheit verbunden. Doch einige vegane Produkte sind oft stark verarbeitet und kommen teilweise nicht ohne Geschmacksverstärker, Farbstoffe, Aromastoffe, Verdickungsmittel oder Konservierungsstoffe aus. Diese verstecken sich meist hinter Zahlen auf der E-Nummern-Liste. Die mit der Veganblume gekennzeichneten Produkte sind also nicht zwangsläufig gesünder als Produkte ohne Siegel. Auch sagt das Siegel nichts darüber aus, ob ein Produkt Bio ist oder fair gehandelt wurde.20
Tierschutzsiegel

Tierschutzlabel „Für Mehr Tierschutz“
Mit dem Tierschutzlabel „Für Mehr Tierschutz“ des Deutschen Tierschutzbundes werden seit 2013 Produkte tierischen Ursprungs gekennzeichnet, denen Tierschutzstandards zugrunde liegen, die für die Tiere einen wirklichen Mehrwert an Tierschutz gewährleisten. Die Standards sollen es den Tieren in der Landwirtschaft ermöglichen, ihren artspezifischen Verhaltensweisen und den damit verbundenen Bedürfnissen an ihre Haltungsumgebung nachzukommen. Dies ist durch die gesetzlichen Vorgaben bislang bei Weitem nicht gewährleistet. Das Label gibt es für Masthühner, Mastschweine, Legehennen und Milchkühe. Die Kriterien sollen aber langfristig für alle landwirtschaftlich genutzten Tiere erarbeitet werden.21
Zwei Labelstufen: Einstieg und Premium
Es gibt zwei Varianten: Einstiegsstufe und Premiumstufe. In beiden müssen definierte Anforderungen an Tierhaltung, Tiertransport und Schlachtung erfüllt werden. Darüber hinaus wird das Verhalten und die körperliche Verfassung der Tiere überprüft. Damit soll sichergestellt werden, dass die Maßnahmen auch wirklich zum Wohlbefinden der Tiere beitragen und gegebenenfalls nachgebessert werden. Unabhängige, fachkundige Kontrolleure und der Deutsche Tierschutzbund selbst stellen durch unangekündigte Kontrollen sicher, dass diese Anforderungen eingehalten werden.22
- Einstiegsstufe: Hier haben die Tiere mehr Platz und Beschäftigungsmöglichkeiten. Es gibt zudem eine Begrenzung, wie viel Gewicht die Tiere in einem bestimmten Zeitraum zulegen dürfen. Die Anforderungen an Transport und Schlachtung sind streng. Damit geht die Einstiegsstufe deutlich über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus. Nichtsdestotrotz sei das „aber noch kein sehr hohes Tierschutzniveau“, laut Verbraucherzentrale.
- Premiumstufe: Diese Stufe beinhaltet Auslauf und Freilandhaltung für die Tiere. Das Urteil der Verbraucherzentrale lautet: „Das Label der Premiumstufe kennzeichnet ein hohes Tierschutzniveau im Vergleich zum gesetzlichen Standard.“23
Hier kannst du dir die detaillierten Kriterien zu den beiden Zertifizierungsstufen nochmal anschauen:
- Einstiegsstufe: https://www.tierschutzlabel.info/tierschutzlabel/einstiegsstufe/
- Premiumstufe: https://www.tierschutzlabel.info/tierschutzlabel/premiumstufe/
Die Unterschiede zwischen Biofleisch und dem Tierschutzlabel
Im Mittelpunkt des ökologischen Landbaus steht die Schonung von Natur und Umwelt. Die europäischen Vorschriften für den ökologischen Landbau regeln neben den Umweltkriterien auch Tierschutzaspekte. Die Anforderungen an die Haltung der Bio-Tiere sind etwa mit denen der Premiumstufe des Tierschutz-Labels vergleichbar: Viel Platz und Einstreu in den Ställen sowie Auslauf im Freien. Bei den Bio-Tieren kommen als wichtige ökologische Kriterien zum Beispiel hinzu:
- Biofutter
- Eine Begrenzung der Tierzahl, die ein Betrieb pro Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche halten darf. Dadurch soll die Umwelt möglichst wenig belastet werden.
Die EU-Biovorschriften machen jedoch keine speziellen Vorgaben für Transport und Schlachtung der Tiere. Es gelten die gesetzlichen Mindestanforderungen für alle Tiere. Tierbezogene Kriterien werden nur in den Mitgliedsbetrieben der deutschen Bioverbände in der jährlichen Biokontrolle erhoben. Die EU-Öko-Verordnung enthält keine Vorschriften zu tierbezogene Kriterien.22 Wenn du mehr über die ökologische Tierhaltung erfahren möchtest, kannst du im folgenden Informationsportal vorbeischauen: https://www.oekolandbau.de/landwirtschaft/tier/
Quellen
- https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/essen-und-trinken/bio-fair-regional/labels/15583.html
- https://utopia.de/siegel/eu-bio-siegel/
- https://utopia.de/ratgeber/bio-discounter-experten-meinung-aldi-bio-lidl-bio/
- https://www.bioland.de/sieben-prinzipien
- https://utopia.de/galerien/guetesiegel-uebersicht/#11
- https://utopia.de/siegel/bioland/
- https://www.demeter.de/organisation
- https://utopia.de/siegel/demeter/
- https://naturland.de/de/naturland/wer-wir-sind.html
- https://utopia.de/siegel/naturland/
- https://naturland.de/de/naturland/was-wir-tun/naturland-fair/kriterien-richtlinien.html
- https://utopia.de/siegel/gepa/
- https://www.gepa.de/gepa/mission/wer-ist-die-gepa.html
- https://utopia.de/siegel/fairtrade-siegel-bedeutung-kritik/
- https://www.rapunzel.de/hand-in-hand.html
- https://www.ci-romero.de/kritischer-konsum/siegel-von-a-z/label/35-rapunzel/
- https://utopia.de/siegel/rainforest-alliance/
- https://utopia.de/siegel/ecoveg-siegel-vegane-bio-lebensmittel/
- https://utopia.de/siegel/v-label/
- https://utopia.de/siegel/veganblume/
- https://www.tierschutzbund.de/information/hintergrund/landwirtschaft/tierschutzlabel/
- https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/lebensmittelproduktion/das-label-fuer-mehr-tierschutz-22086
- https://utopia.de/ratgeber/fleisch-labels-und-siegel-der-discounter-sauerei-im-kuehlregal/
- https://utopia.de/galerien/guetesiegel-uebersicht/#15
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen